Zusammenfassung
Ziel der Studie Die vorliegende Studie untersucht die Versorgungsstrukturen mit stationär installierten Computertomographen (CT) und Positronenemissionstomographen (PET) 20 Jahre nach Aufhebung der Standortplanung medizintechnischer Großgeräte.
Methodik Mittels kartographischer Analysen wird die stationäre Versorgungssituation mit CT und PET zwischen 2010 und 2017 visualisiert. Regionale Unterschiede werden in Relation zu Einwohnerzahlen und Krankheitslast gesetzt, um potenziell über- oder unterversorgte Gebiete zu identifizieren.
Ergebnisse Für CT ist eine nahezu flächendeckende Versorgung festzustellen. Lediglich 0,3% der Bevölkerung erreichen kein Gerät innerhalb von 30 Fahrminuten. Hinsichtlich der Versorgung mit PET liegen hingegen weiträumig nicht zeitnah versorgungsfähige Regionen vor, die einen größeren Teil der Bevölkerung betreffen. Darüber hinaus weist die Versorgung eine hohe regionale Variation auf, welche weder durch die Einwohnerdichte noch Krankheitslast der Region erklärt werden kann.
Schlussfolgerung Die seit Jahrzehnten gewachsenen Versorgungsstrukturen mit medizintechnischen Großgeräten ohne konkrete regulative Maßnahmen zeugen von zum Teil starken regionalen Versorgungsunterschieden. Diese sind sowohl aus ökonomischer als auch medizinischer Perspektive kritisch zu betrachten. Inwiefern eine weitere Ausgestaltung wettbewerblicher Parameter oder eine mögliche sektorübergreifende Standortplanung zu einer bedarfsgerechten und effizienten Versorgungssituation im Bereich medizintechnischer Großgeräte führen kann, gilt es noch näher zu untersuchen.
Schlüsselwörter: Versorgungsforschung, Medizintechnische Großgeräte, Regionale Variation, Unterversorgung, Überversorgung
Abstract
Aim The aim of this study was to examine the supply structures of computer tomographs (CT) and positron emission tomographs (PET) 20 years after abolishing site planning of large-scale medical equipment in the German inpatient sector.
Methodology Cartographic analyses were used to visualize the inpatient supply with CT and PET between 2010 and 2017. Regional differences were investigated in relation to population and disease burden to identify potentially over- and under-served areas.
Results Almost German-wide coverage was observed for CT. Only 0.3 percent of the population did not have access to a device within 30 minutes of driving distance. In contrast, larger segments of the population in extensive regions did not have timely access to PET. In addition, there was a high degree of regional variation in supply, which could not be explained either by population density or the disease burden of the region.
Conclusion The supply structures of large-scale medical equipment over decades without concrete regulatory interventions reveal regional variation. This is to be viewed critically from both an economic and a medical perspective. The extent to which strengthening competitive elements or cross-sectoral site planning can lead to a demand-oriented and efficient supply of large-scale medical equipment still needs to be investigated in more detail.
Key words: Health Services Research, Large-Scale Medical Equipment, Regional Variation, Undersupply, Oversupply
Einleitung
Bildgebende Verfahren nehmen einen wichtigen Stellenwert in der Gesundheitsversorgung ein, stellen aber auch einen wesentlichen Kostenfaktor dar. Sie werden zur Diagnose krankheitsbedingter Veränderungen in Organen und Strukturen bei Patientinnen und Patienten eingesetzt und sind damit eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz anschließender Behandlungen 1 . Gleichzeitig muss eine hohe Versorgungsdichte mit medizintechnischen Großgeräten nicht mit einer effektiven und effizienten Versorgung von Patientinnen und Patienten einhergehen. Der Markt dieser ist seit vielen Jahren durch hohe Wachstumsquoten gekennzeichnet. Allein in den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl an stationär installierten medizintechnischen Großgeräten in Deutschland von 1985 auf 12 260 mehr als versechsfacht 2 . In einem Vergleich der OECD-Länder für das Jahr 2019 liegt Deutschland mit 35,1 Computertomographen (CT) pro eine Million Einwohner im internationalen Vergleich auf Platz acht ( Abb. 1 ). Hinsichtlich der Ausstattung mit und der Anwendung von Magnetresonanztomographen (MRT) befindet sich Deutschland mit 34,7 Geräten pro eine Million Einwohner an dritter Stelle und mit 143 Scans pro 1 000 Einwohner sogar an der Spitze 3 4 . Eine ähnliche Entwicklung lässt sich für Positronenemissionstomographen (PET) beobachten. Die ersten PET in Deutschland wurden 1988 in Betrieb genommen 5 . Mittlerweile hat sich der Bestand auf über 120 stationär installierte Gerät erhöht und weist eine der höchsten Wachstumsraten im Vergleich zu anderen bildgebenden Verfahren in Deutschland über die letzten Jahrzehnte auf 2 .
Abb. 1.

Ausstattung mit CT, MRT und PET pro 1 Mio. Einwohner im internationalen Vergleich für 2019 bzw. nächstgelegenes Jahr (basierend auf 3 4 ).
Für PET liegt die Gerätedichte etwas über dem europäischen Mittel, wenngleich ambulant betriebene Geräte für Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern nicht enthalten sind. Aber nicht nur über die Geräte oder Länder hinweg, sondern auch innerhalb eines Landes lassen sich große Variationen feststellen 3 . Eine aktuelle Analyse der belgischen Gesundheitsdaten zeigt eine geografische Variation der standardisierten Einsatzraten diagnostischer Bildgebung des Rückens in Höhe von 50% 6 . Auch der Nationale Gesundheitsdienst in England attestiert starke regionale Unterschiede in der Versorgung mit CT- oder MRT-Geräten 7 . Eine solche als ungerechtfertigt bzw. unerwünscht bezeichnete Variation beschreibt eine nicht-zufällige Abweichung, die nach Wennberg 8 nicht mit Krankheitslast, medizinischer Evidenz oder Patientenpräferenzen erklärt werden kann. Diese unerwünschte Variation signalisiert eine übermäßige oder ungenügende Versorgung mit medizinischen Leistungen und beeinträchtigt die Qualität, Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung 9 .
Auf der einen Seite kann der Einsatz bildgebender Verfahren zu frühzeitigen sowie präzisen Diagnosestellungen und im Falle von vorhanden Behandlungsmöglichkeiten zu verbesserten Gesundheitsoutcomes führen 10 . Auf der anderen Seite birgt die inhärente Strahlenexposition ein Gesundheitsrisiko mit nicht abschätzbaren Folgen 11 , welches durch übermäßige, nicht indizierte Anwendungen vermieden werden muss. Darüber hinaus stellen auch Zufallsbefunde ein Problem dar, wenn beispielsweise keine oder ausschließlich riskante Therapiemöglichkeiten vorhanden sind oder sich Befunde nach invasiven Folgeuntersuchungen als harmlos herausstellen. Unnötige Gefährdungen, Angstzustände und Einschränkungen in der Lebensqualität können daraus resultieren 12 . Um einer unkontrollierten Verbreitung von Großgeräten entgegenzuwirken, sind einige Länder wie z. B. Österreich, Frankreich oder die Vereinigten Staaten dazu übergegangen, die Diffusion und Distribution von Großgeräten zu planen 12 . Auch in Deutschland führten die hohen Zuwachsraten zu einem staatlichen Planungsansatz mit der Einführung eines Großgeräteausschusses durch das Gesundheitsreformgesetz im Jahr 1989. Dieser wurde allerdings wenige Jahre später mit Einführung des 2. GKV-Neuordnungsgesetzes im Jahr 1997 wieder aufgelöst. Im Gesetzesentwurf hieß es „Diese Form der Großgeräteplanung hat die Entstehung von Überkapazitäten nicht verhindern können“ 13 .
Somit zielt die vorliegende Studie darauf ab, die Verteilung ausgewählter Großgeräte (CT und PET, hier: inkl. PET-CT und PET-MRT) 20 Jahre nach Aufhebung der Standortplanung zu betrachten und hinsichtlich regionaler Unterschiede zu untersuchen, um potenziell über- oder unterversorgte Gebiete zu identifizieren.
Methodik
Das Instrument der Kartographie wurde genutzt, um die Infrastruktur der Geräte zu visualisieren und Versorgungsunterschiede zwischen den Regionen zu identifizieren. Standorte stationärer Einrichtungen mit mindestens einem CT oder PET wurden aus den aggregierten strukturierten Qualitätsberichten extrahiert und für die Jahre 2010 bis 2017 ausgewertet. Als Grundlage wurden die Planungsrichtwerte des Österreichischen Strukturplans (ÖSG) 14 zur Erreichbarkeit von Großgeräten herangezogen. Gemäß dem ÖSG liegt die Erreichbarkeitsfrist bei 30 Minuten für die Versorgung mit CT und 60 Minuten mit PET. Innerhalb dieser Spanne sollen zumindest 90% der Bevölkerung im Straßen-Individualverkehr den nächstgelegenen Standort mit einem Großgerät erreichen 14 . Mithilfe von Radien, die den Fahrzeitminuten im realen Straßenverkehr entsprechen, wurden Polygone um die Standorte der Geräte gezogen, in denen die Erreichbarkeitsfrist erfüllt ist. Somit können unabhängig von administrativen Grenzen Regionen identifiziert werden, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Um eine unerwünschte Variation der Großgeräteverteilung zu erkennen, wurde hinsichtlich der Bevölkerungsdichte und des medizinischen Bedarfs einer Region kontrolliert. Über den Zensus 2011 15 wurden die Anzahl der Bewohner eines jedes 100-Quadratmeter-Gitters eingeschlossen. Der medizinische Bedarf wurde über eine Morbiditätsvariable M modelliert, die auf allen innerhalb der DRG-Statistik kodierten Diagnosen nach ICD-10-GM sowie dem Geschlecht und Alter aller akutstationären Fälle eines Jahres basiert 16 . Diese gibt die kumulierte Wahrscheinlichkeit für die Notwendigkeit einer Bildgebung mit dem entsprechenden Großgerät für alle Fälle eines Kreises an (vgl. Formel 1, für CT analog).
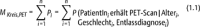
n −Anzahl Patientinnen und Patienten eines Kreises
Die individuelle Wahrscheinlichkeit P i wurde mittels der Häufigkeiten der deutschlandweiten Fälle geschätzt:

In einem letzten Schritt wurde die stationäre Versorgungssituation in Relation zu den ambulanten Strukturdaten der Leistungserbringung gesetzt. Diese wurde approximativ über die Anzahl an Niederlassungssitzen von Radiologen und Nuklearmedizinern angenähert, die über das Bundesarztregister der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zur Verfügung gestellt wurden 17 . Hierfür diente eine Korrelationsanalyse nach Pearson, sodass abgeleitet werden kann, ob die Sektoren als Komplemente oder Substitute agieren.
Ergebnisse
In den Abb. 2 und 3 ist die Erreichbarkeit der jeweiligen Großgeräte in einer stationären Einrichtung innerhalb der vorgegebenen Frist für die Jahre 2010 und 2017 visualisiert. Dunkelgrau eingefärbte Regionen weisen die beste Erreichbarkeit auf – mit bis zu 83 bzw. 11 Krankenhäusern mit mindestens einem CT bzw. PET innerhalb von 30 bzw. 60 Fahrminuten. Einwohner in den schwarz eingefärbten Flächen erreichen kein stationäres Großgerät innerhalb dieser Frist.
Abb. 2.

CT-Erreichbarkeit stationärer Einrichtungen innerhalb von 30 Fahrminuten für 2010 und 2017, adjustiert nach Einwohnern.
Abb. 3.

PET-Erreichbarkeit stationärer Einrichtungen innerhalb von 60 Fahrminuten für 2010 und 2017, adjustiert nach Einwohnern.
Gemäß Abb. 2 ist die Erreichbarkeit von stationär betriebenen CT über ganz Deutschland hinweg größtenteils gewährleistet. Die höchste Versorgungsdichte ist im Ballungsraum des Ruhrgebiets mit Ausdehnung bis nach Bonn zu verzeichnen. Weiterhin verfügen die Großstadtregionen Berlin, Bielefeld, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg und der Gürtel von Stuttgart über Karlsruhe bis Frankfurt am Main über mehrere, fristgerecht erreichbare stationäre Einrichtungen mit CT. Im Nordosten sowie der Mitte Deutschlands finden sich vereinzelt Regionen, in denen Patientinnen und Patienten mehr als 30 Minuten Fahrzeit aufwenden müssen. Während dies im Jahr 2010 noch 466 111 Einwohner und somit 0,6% der Gesamtbevölkerung Deutschlands betraf, hat sich der Anteil im Jahr 2017 auf 0,3% halbiert. Im Zeitverlauf hat sich die Versorgung noch weiter in ländliche, bislang nicht versorgte Gebiete ausgebreitet.
Die Versorgungsdichte mit stationären Einrichtungen, die ein PET vorhalten ( Abb. 3 ), ist deutlich geringer als im Vergleich zu CT. Bis auf den Ballungsraum Berlin sind weite Teile Ost- sowie Norddeutschlands nicht innerhalb der 60-Minuten-Frist versorgt. Insbesondere Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern weisen Versorgungslücken auf. Die höchste Gerätedichte mit 11 PET (nicht einwohneradjustiert) befindet sich im Zentrum Nordrhein-Westfalens und dem Grenzgebiet zu Niedersachsen, in der Region zwischen Frankfurt am Main und Heidelberg sowie dem Ballungsraum Berlin. Bemerkenswerterweise liegen die Regionen des höchsten Versorgungsgrades nicht innerhalb der Großstädte, sondern vielmehr in der Schnittmenge zweier Erreichbarkeitspolygone, welche oftmals außerstädtisch gelegen sind. Der Anteil der Bevölkerung, der gemäß Erreichbarkeitsfrist mit PET versorgt ist, stieg zwischen 2010 und 2017 von 85,9 auf 89,2%. Zudem scheint eine Intensivierung der bereits bestehenden Cluster zu erfolgen.
Abb. 4 zeigt den medizinischen Bedarf der Bevölkerung einer Region als die relative Krankheitslast der für die bildgebenden Verfahren relevanten Erkrankungen. Die Landkreise Uckermark und Gera im Speziellen sowie Brandenburg und Hessen im Allgemeinen weisen eine für PET hohe Krankheitslast auf, gehören gemäß Abb. 3 jedoch zu den minder bzw. gar nicht versorgten Gebieten. Für CT zeigen sich ähnliche Beobachtungen. Die in den Abb. 2 und 3 beobachteten Variationen scheinen nicht durch den medizinischen Bedarf erklärbar. Einzig in Teilen Nordrhein-Westfalens und des Saarlands scheint eine Korrelation zwischen Gerätedichte und relativer Krankheitslast vorzuliegen. Insgesamt zeichnet sich ein Ost-West-Gefälle ab. Abb. 5 zeigt zudem, dass die Anzahl der stationären und ambulanten Leistungserbringer je Kreis einer positiven linearen Korrelation unterliegt (CT: R=0,26; p<0,001 | PET: R=0,4; p<0,001). Es ist daher anzunehmen, dass in stationär minder ausgestatten Regionen keine hohe Substitution durch den ambulanten Sektor erfolgt.
Abb. 4.

Relative Krankheitslast der Landkreise und kreisfreien Städte für CT (links) und PET (rechts) im Jahr 2017.
Abb. 5.

Pearson-Korrelation der stationären und ambulanten Versorgungsstrukturen für CT (oben) und PET (unten 19).
Diskussion
Die Visualisierung der Erreichbarkeiten stationärer Einrichtungen mit mindestens einem CT oder PET nach Adaption der österreichischen Planungsparameter zeichnet ein heterogenes Bild. Für CT ist eine nahezu flächendeckende Versorgung festzustellen. Lediglich 0,3% der Bevölkerung befinden sich außerhalb der 30-Minuten-Erreichbarkeitsfrist. Diese Tatsache ist hinsichtlich des akutmedizinischen Einsatzes der Geräte positiv zu bewerten. Wenngleich somit eine Unterversorgung größtenteils auszuschließen ist, sind Gebiete mit Anschluss an 83 Krankenhausstandorte mit entsprechenden Geräten vielmehr dem Risiko einer Überversorgung ausgesetzt. Die vorgehaltenen Strukturen können Anreize einer angebotsinduzierten Nutzung der Geräte bieten 18 mit Folgen für die betroffenen Patientinnen und Patienten hinsichtlich vermeidbarer Strahlenexposition und Zufallsdiagnostik.
Hinsichtlich der Versorgung mit PET liegen hingegen weiträumig nicht zeitnah versorgungsfähige Regionen vor, die einen größeren Teil der Bevölkerung betreffen. Die Geräte sind v. a. in Städten mit einer hohen Einwohnerdichte angesiedelt, während die Flächenländer Bayern, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie die Küstenregion der Nordsee weitere Distanzen zu einem Gerät aufweisen. Die zunächst augenscheinlich mangelnde Versorgung mit PET täuscht jedoch. Nur 10,8% der Bevölkerung und somit nur wenige mehr als die definierte Grenze von 10% erreichen kein PET innerhalb von 60 Fahrminuten. Dennoch weist die Versorgung eine hohe regionale Variation auf, welche weder durch die Einwohnerdichte noch Krankheitslast der Region erklärt werden kann. Um eine unerwünschte Variation in der Verteilung der Großgeräte gemäß Wennberg 8 zu identifizieren, bedarf es darüber hinaus auch einer Kontrolle der Unterschiede der Patientenpräferenzen sowie des Evidenzstandes. Patientenseitige Präferenzen werden relevant, wenn mehrere Optionen in einer vollumfänglichen nicht-direktiven Beratung zur Auswahl gestellt werden. Weiterhin können Versorgungsunterschiede durch eine ungeklärte Evidenzlage und daraus resultierenden Entscheidungsspielräumen resultieren 9 . Im Bereich von diagnostischen im Vergleich zu therapeutischen Verfahren gilt jedoch insbesondere die Evidenzbasis als allgemeinhin schwächer 7 12 , sodass hierdurch nicht-beobachtete Einflüsse zu erwarten sind. Patientenpräferenzen und Evidenzbasis sollten daher in Folgestudien berücksichtigt werden.
Die geringe Verbreitung der PET im Vergleich zur CT lässt sich einerseits durch die Elektivität und den Spezialisierungsgrad begründen, welcher hinsichtlich der Erreichbarkeitsfristen allerdings bereits durch die doppelte Anzahl an Fahrminuten abgebildet ist. Andererseits ist die Verbreitung unter Beachtung der verschiedenen Adoptionsstadien der Technologien zu bewerten. Nach der Adoptionstheorie werden die Geräte zunächst von den Innovatoren und frühzeitigen Anwendern eingeführt. Im vorliegenden Fall betrifft dies zumeist Universitätskrankenhäuser, welche in größeren Städten angesiedelt sind. Mit steigender Verbreitung und daraus resultierendem Wettbewerb, dehnt sich die Geräteverteilung in den ländlichen Bereich aus 20 . Somit kann beobachtet werden, dass die bereits etablierte Computertomographie mit einer Sättigung in stark bevölkerten Regionen einhergeht und im Zeitverlauf mit einer Ausbreitung in ländliche Regionen und somit einer Vergleichmäßigung der Versorgung einhergeht. Die PET-Technologie ist hingegen erst seit den späten 1990er Jahren in Deutschland verbreitet 12 und befindet sich in einem früheren Adoptionsstadium. Die Geräteverteilung sollte somit einer dynamischen Betrachtung unterliegen.
Hinsichtlich der Erreichbarkeitsfristen wirkt limitierend, dass die vorliegende Analyse einzig die stationär betriebenen CT und PET einschließt, da standortgenaue Angaben zu ambulanten Geräten nicht verfügbar waren. Dieser Mangel unterstreicht die fehlende Planungsgrundlage sowie die Relevanz einer aktuellen sektorübergreifenden Erfassung der Versorgungssituation in Deutschland. Unter Hinzunahme der Korrelationsanalyse lässt sich allerdings die Hypothese ableiten, dass die festgestellten stationären Defizite in der Versorgung mit den betrachteten Großgeräten auch durch die ambulanten Strukturen nicht ausgeglichen werden. Eine substitutive Funktion der Sektoren kann zumindest auf Grundlage der Niederlassungssitze nicht angenommen werden. Eine weitere Limitation ist durch die binäre Angabe der Geräteverfügbarkeit in den strukturierten Qualitätsberichten bedingt, sodass die berechnete Gerätedichte in einzelnen Regionen vermutlich unterschätzt ist. Die Daten lassen ferner keinen Rückschluss auf die Auslastung sowie den 24-h-Betrieb einzelner Geräte zu. Damit können keine Aussagen zur Terminwartezeit getroffen werden, welche bei der Bewertung des tatsächlichen Zugangs der Bevölkerung eine Rolle spielt 21 . Die subjektive Wahrnehmung des Zugangs aus Patientensicht kann sich indes erheblich von den gemessenen Indikatoren unterscheiden. Darüber hinaus ist der Zugang zu PET aufgrund der Diskussion um den patientenrelevanten Nutzen kritisch zu bewerten 12 . Die ungeklärte Evidenzlage könnte ursächlich für eine im Vergleich zu anderen Ländern verhaltene Nutzung sein 23 . Trotz geringer Inanspruchnahme befindet sich Deutschland hinsichtlich der Pro-Kopf-Ausstattung über dem Durchschnittsniveau. Im Zeitverlauf ist zudem eine weitere Zunahme der Geräte insbesondere in bereits hoch versorgten Gebieten zu beobachten. In Bezug zu den Auslastungszahlen und -grenzen 16 23 24 ist anzunehmen, dass die vorhandenen PET den jetzigen Bedarf der deutschen Bevölkerung ausreichend decken könnten, allerdings regional betrachtet Versorgungslücken bestehen. Zudem gilt es das überregionale Ost-West-Gefälle abzubauen, das in weiten Bereichen der Gesundheitsversorgung vorliegt 25 26 .
Die Übergabe der Großgeräteplanung an die Selbstverwaltung im Jahr 1997 blieb bislang tatenlos. Die Verteilung von CT und PET unterliegt zwar indirekt der Krankenhausplanung der Länder sowie der Bedarfsplanung von Niederlassungssitzen, die tatsächliche Ausstattung obliegt allerdings den Leistungserbringern. Untersuchungen geben Hinweise darauf, dass selbstregulierende Marktmechanismen zu einer optimalen Allokation von medizinischen Gütern führen können 20 27 , indem sie das Verhalten der Anbieter formen 19 28 . Der wettbewerbliche Ansatz der Betriebskostenabrechnung im stationären Sektor 29 wird im Bereich von medizintechnischen Großgeräten allerdings durch die föderale Krankenhausplanung und -finanzierung konterkariert. Wie die vorliegende Analyse aufzeigt, scheint die Koexistenz beider Systeme die Realisierung einer optimalen Verteilung zu behindern. Im Falle einer erneuten staatlichen Planung sollte neben den objektiven sowie subjektiv wahrgenommen Zugangsmöglichkeiten ein besonderes Augenmerk auf die sektorübergreifende Planung gelegt werden. In minder versorgten Regionen, insbesondere im Bereich der nicht notfallmedizinischen Diagnostik, könnten somit Synergievorteile realisiert werden. In potenziell überversorgten Regionen hingegen, vermögen Choosing-Wisely-Intitiativen unnötige medizinische Leistungen zu reduzieren 30 . Inwiefern eine weitere Ausgestaltung wettbewerblicher Parameter zu einer optimierten Versorgungssituation im Bereich medizintechnischer Großgeräte führen könnte, gilt es in weiteren Untersuchungen zu klären.
Die vorliegende Arbeit bietet einen ersten Überblick über die seit Jahrzehnten gewachsenen Versorgungsstrukturen mit medizintechnischen Großgeräten ohne konkrete regulative Maßnahmen. Zwanzig Jahre nach der Debatte können zum Teil starke regionale Versorgungsunterschiede festgestellt werden. Diese sind – unabhängig der Schwierigkeiten einen optimalen medizinischen Versorgungsgrad im Bereich diagnostischer Bildgebung zu eruieren 3 – sowohl aus ökonomischer als auch medizinischer Perspektive kritisch zu betrachten.
Danksagung
Wir bedanken uns bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) für die Zurverfügungstellung der Anzahl an Niederlassungssitzen von Radiologen und Nuklearmedizinern des Bundesarztregisters.
Footnotes
Interessenkonflikt Die Autorinnen/Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Literatur
- 1.Malbaski N, Teichert T. Versorgungsdichte und wirksamkeit in den Bereichen Computertomographie und Magnetresonanztomographie. Evidenzbasierte Wirtschaftliche Gesundheitsversorgung. 2019.
- 2.Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Medizinisch-technische Großgeräte in Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Anzahl und Dichte). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Art des Großgerätes, Einrichtungsmerkmale (Einrichtungsart/Bettenzahl/Art der Zulassung/Träger). Im Internet:www.gbe-bund.de Stand: 16.12.2019
- 3.OECD . Paris: OECD Publishing; Health at a Glance 2019: OECD Indicators; p. 2019. [DOI] [Google Scholar]
- 4.OECD.Stat. Dataset: Health Care Resources – Medical Technology. Im Internet:https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_LTCR Stand: 30.10.2020
- 5.Bruckenberger E.Standortplanung für den wirtschaftlichen Einsatz von Großgeräten – Erfahrungen und politische Implikation aus Ländersicht. Workshop des AOK-Bundesverbandes Kapazitätssteuerung im ambulanten Bereich. Im Internet:http://www.bruckenberger.de/ 16.12.2019
- 6.INAMI/RIVIZ. Medical Practice Variations. Spine imaging – CT scan. Brüssel; 2019
- 7. Public Health England and NHS RightCare. The 2 nd Atlas of Variation in NHS Diagnostic Services in England. Reducing unwarranted variation to improve health outcomes and value. London; 2017 Stand: 16.12.2019
- 8.Wennberg J E. New York: Oxford University Press; 2010. Tracking medicine: A researcherʼs quest to understand health care. [Google Scholar]
- 9.Grote-Westrick M, Klemperer D. Gütersloh: 2015. Unerwünschte regionale Unterschiede – Was hat sich in Deutschland getan? In: Bertelsmann Stiftung, Hrsg. Faktencheck Gesundheit. Regionale Unterschiede in der Gesundheitsversorgung im Zeitvergleich; pp. 8–24. [Google Scholar]
- 10.Sandoval G A, Brown A D, Wodchis W P et al. Adoption of high technology medical imaging and hospital quality and efficiency: Towards a conceptual framework. Int J Health Plann Manage. 2018;33:e843–e860. doi: 10.1002/hpm.2547. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 11.Brenner D J, Hall E J. Computed tomography – an increasing source of radiation exposure. N Engl J Med. 2007;357:2277–2284. doi: 10.1056/NEJMra072149. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 12.Fuchs S, Grössmann N, Eckhardt H PET/PET-CT Evidenz zum Bedarf und zur Planung in Deutschland und Österreich. HTA Projektbericht Nr. 77 update
- 13.Deutscher Bundestag. Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP: Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Neuordnung von Selbstverwaltung und Eigenverantwortung in der gesetzlichen Krankenversicherung (2. GKV-Neuordnungsgesetz). Drucksache 13/6087
- 14.Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. ÖSG 2017. Österreichischer Strukturplan Gesundheit 2017 inklusive Großgeräteplan gemäß Beschluss der Bundes-Zielsteuerungskommission vom 30. Juni 2017. Wien; 2019
- 15.Zensus 2011. Gitterzellenbasierte Ergebnisse: Bevölkerung im 100 Meter-Gitter. Im Internet:https://www.zensus2011.de/DE/Home/Aktuelles/DemografischeGrunddaten.html Stand: 11.10.2019
- 16.Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes. DRG-Statistik 2010 bis 2017
- 17.Bundesarztregister/Kassenärztliche Bundesvereinigung, Freigabedatum 10.10.2019
- 18.Hodek J-M, Greiner W. Kostensteigerungen im Gesundheitswesen. GuS. 2010;64:26–36. doi: 10.5771/1611-5821-2010-6-26. [DOI] [Google Scholar]
- 19.Dreger M, Langhoff H, Henschke C. Adoption of large-scale medical equipment: the impact of competition in the German inpatient sector. Eur J Health Econ 2021. https://doi.org/10.1007/s10198-021-01395-w [DOI] [PMC free article] [PubMed]
- 20.Matsumoto M, Koike S, Kashima S et al. Geographic Distribution of CT, MRI and PET Devices in Japan: A Longitudinal Analysis Based on National Census Data. PLoS ONE 2015; 10: e0126036. doi:10.1371/journal.pone.0126036 [DOI] [PMC free article] [PubMed]
- 21.Schröder SL, Martin O, Mlinarić M et al. „Das liegt an jedem selbst“ –Eine qualitative Studie zu Versorgungsungleichheiten aus Patientensicht. Gesundheitswesen 2019; 81: 564–569. doi:10.1055/s-0043-122231 [DOI] [PubMed]
- 22.Baier N, Pieper J, Schweikart J et al. Capturing modelled and perceived spatial access to ambulatory health care services in rural and urban areas in Germany. Soc Sci Med 2020; 265: 113328. doi:10.1016/j.socscimed.2020.113328 [DOI] [PubMed]
- 23.Kotzerke J, Oehme L, Grosse J et al. Positronenemissionstomographie 2013 in Deutschland. Ergebnisse der Erhebung und Standortbestimmung. Nuklearmedizin. 2015;54:53–59. doi: 10.3413/Nukmed-2015020001. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 24.Deutsche Forschungsgemeinschaft. Stellungnahme zur apparativen Ausstattung universitärer Nuklearmedizin. Verabschiedet vom Apparateausschuss der DFG und der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin; 2018
- 25.Kroll L E, Schumann M, Nowossadeck E et al. Regionale Prognose der Morbidität in Deutschland bis 2035: Ergebnisse und Methoden am Beispiel des subjektiven Gesundheitszustandes. Gesundheitswesen. 2016:78-A51. doi: 10.1055/s-0036-1586561. [DOI] [Google Scholar]
- 26.Spoden M. Amputationen der unteren Extremität in Deutschland – Regionale Analyse mit Krankenhausabrechnungsdaten von 2011 bis 2015. Gesundheitswesen. 2019;81:422–430. doi: 10.1055/a-0837-0821. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 27.Barros P P, Brouwer WB F, Thomson S et al. Competition among health care providers: helpful or harmful? Eur J Health Econ. 2016;17:229–233. doi: 10.1007/s10198-015-0736-3. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 28.Gaynor M, Town R J. Amsterdam: Elsevier North Holland; 2012. Competition in Health Care Markets. In: Pauly MV, Barros PP, McGuire TG, eds. Handbook of Health Economics: Volume 2. Handbooks in economics; pp. 499–637. [DOI] [Google Scholar]
- 29.Geissler A, Scheller-Kreinsen D, Quentin W . Maidenhead: Open University Press; 2011. Germany: understanding G-DRGs. In: Busse R, Geissler, A, Quentin W, Wiley M, eds. Diagnosis-related groups in Europe – moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals; pp. 243–271. [Google Scholar]
- 30.Wild C, Mayer J. Überversorgung: Initiativen zur Identifikation ineffektiver oder nicht bedarfsgerechter Leistungen. Wien Med Wochenschr. 2016;166:149–154. doi: 10.1007/s10354-016-0442-5. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]


