Wie verursacht eine COVID-19-Infektion eigentlich genau das akute Atemwegssyndrom? Und wo liegt der Unterschied zu einer Influenza-Infektion? Dank intensiver Forschung liegen auf diese Fragen nun Antworten vor - die Wissenschaftler gewinnen immer mehr neue Erkenntnisse. Doch auch andere Infektionen werden immer besser verstanden. Erfahren Sie Neues zu HIV, Corona, Pneumokokken & Co. in unserem Schwerpunkt "Infektionen" ab Seite 24!

Claudia Daniels
Redakteurin
Online-Dossier zu COVID-19.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Springer Medizin informiert Sie kostenfrei über die wichtigen Fakten und neuesten Entwicklungen online in einem eigenen Dossier unter www.springermedizin.de/covid-19
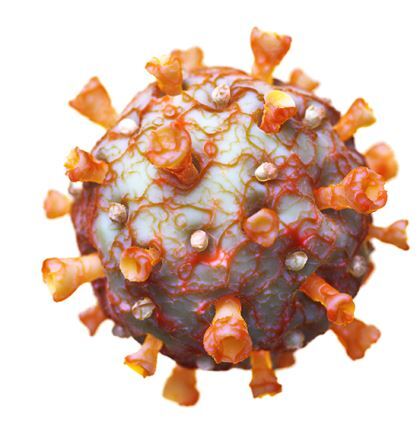
Zudem finden Sie freizugänglich in englischer Sprache die neuesten Forschungsergebnisse unter www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus
Weitere wichtige Informationsquellen:
Robert Koch Institut: Risikobewertung, Fallzahlen, Informationen zu Diagnose, etc. (www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html)
Deutsche Gesellschaft für Pneumologie: Informationen zu Diagnose und Therapie von Covid-19 (https://pneumologie.de/aktuelles-service/aktuelles/?L=0)
Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI): Register der Kliniken mit freien Beatmungsbetten (www.divi.de/register/intensivregister)
Bundesministerium für Gesundheit: Tagesaktuelle Informationen (www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html)
NDR Info-Podcast: tägliches Coronavirus-Update mit Prof. Dr. med. Christian Drosten (www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html)
RKI rechnet mit Corona-Impfstoff bis Anfang 2021.
Das Robert-Koch-Institut (RKI) rechnet damit, dass schon zu Beginn des kommenden Jahres ein oder mehrere Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 in der Europäischen Union zugelassen sein könnten [1]. Es sei aber möglich, dass einzelne Impfstoffe aufgrund ihres Wirksamkeitsprofils nur für bestimmte Personen bzw. Altersgruppen zugelassen werden. Die Wissenschaftler betonen: "Es ist damit zu rechnen, dass nicht von Anfang an genügend Impfstoff zur Verfügung stehen wird, um der gesamten Bevölkerung eine Impfung anbieten zu können, sodass eine Priorisierung notwendig wird." Die Ständige Impfkommission (STIKO) werde daher Empfehlungen zur Priorisierung erarbeiten, um verfügbare Bestände mit dem bestmöglichen Nutzen für die Bevölkerung einzusetzen. Dabei seien ethische Aspekte für eine gerechte Verteilung von besonderer Bedeutung.
1. Epid Bull 35/2020
Wie lange dauert die Anosmie?
Ein großer Teil der SARS-CoV-2-Infizierten weist in der Frühphase der Erkrankung deutliche Riech- und Schmeckstörungen auf. Bei den meisten erholt sich der Geruchssinn anschließend wieder. Dauerhafte Schäden sind jedoch nicht ausgeschlossen. Der Verlauf dieser Einschränkungen steht im Mittelpunkt einer französischen Studie mit 229 Patienten. Der Fokus lag dabei auf dem Geruchssinn, da anhand von Patientenberichten nicht klar zwischen Geschmacksverlust und veränderter Geschmackswahrnehmung aufgrund von Riechstörungen differenziert werden konnte. Etwa zwei Drittel der befragten Patienten berichteten von einer plötzlichen olfaktorischen Beeinträchtigung. Diese trat sowohl einzeln als auch in Verbindung mit weiteren Symptomen auf. 95% der Patienten erholten sich innerhalb eines Monats von der Anosmie, etwa die Hälfte davon vollständig. Bei 78% der Teilnehmer kehrte der Geruchssinn vier bis 15 Tage nach seinem Verschwinden wieder zurück, im Schnitt besserte sich die Störung nach rund zwölf Tagen.
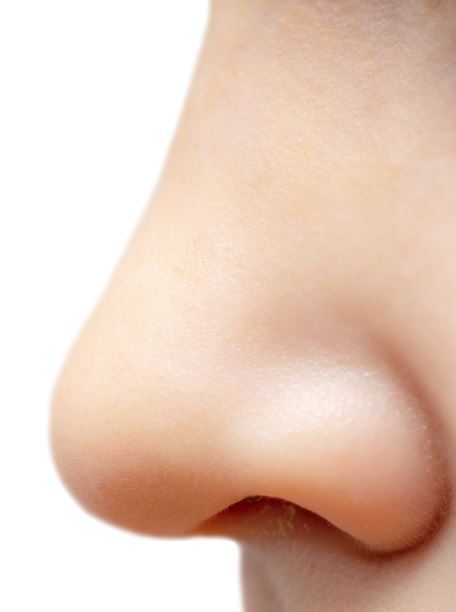
Gorzkowski V et al. Laryngoscope 2020; https://doi.org/10.1002/lary.28957
COVID-19-Risiko mithilfe kardialer Marker einschätzen.
Stationär zu therapierende Kranke mit COVID-19 weisen häufig myokardiale Schäden auf. Das wirkt sich auf die Mortalität aus. Wie sich die Marker hochsensitives kardiales Troponin I (hs-TnI) und B-Typ-natriuretisches Peptid (BNP) prognostisch nutzen lassen, haben Forscher aus Italien untersucht. In ihre Studie bezogen sie die Daten von 397 COVID-19-Patienten ein. Binnen 24 Stunden nach der stationären Aufnahme wurden hs-TnI und BNP bestimmt. Als obere Grenze des Normbereichs galten 19,6 ng/l für hs-TnI und 100 pg/ml für BNP. Im Vergleich zur Sterblichkeit von 6,3% der Patienten ohne erhöhte Markerkonzentrationen war die Mortalität der Patienten mit Markerwerten oberhalb der Norm signifikant gesteigert: auf 22,5% bei zu hohem hs-TnI, auf 33,9% bei erhöhtem BNP und auf 55,6%, wenn beide Herzmarker die Schwellenwerte überschritten.


