Wie oft hören Sie seit Ausbruch der Covid 19-Pandemie von Krankenhausbetten und Intensivmedizin? Wie oft hören Sie von Pflege? Eben. Dabei wäre das Überleben der Erkrankten ohne entsprechende Pflege ebenso wenig möglich wie ohne Infrastruktur und Medizin.
Die Covid 19-Krise verdichtet und verschärft, was sich in den vergangenen Jahrzehnten angestaut hat, und macht deutlich: Die „Pflegekrise“ hat viel größere Ausmaße und trifft unsere Gesellschaft als Ganzes. Sie hat bereits vor der Covid 19-Krisebestanden, wird nachher weiter bestehen und sich aller Voraussicht nach verschärfen. Zwar werden immer wieder die schwierigen Rahmenbedingungen und die unangemessene Bezahlung thematisiert, dennoch ist die einzige wahrnehmbare Reaktion auf den Mangel an Pflegenden, dass mehr geringer qualifizierte Personen eingestellt werden und immer mehr und komplexere Aufgaben übernehmen sollen. Für pflegerische Kernkompetenzen ist in akutstationären Einrichtungen angeblich keine Zeit. Pflege wird auf Handlungen reduziert und viele Personen werden möglichst rasch qualifiziert, um „Hände“ für die Arbeit am Bett zu gewinnen. Damit droht die Deprofessionalisierung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege (GuK). Kompetente Pflege braucht aber nicht nur viele, sondern auch gut qualifizierte Pflegepersonen.
Deprofessionalisierung setzt eine negativ Spirale in Gang. Krankenanstalten und Pflegeheime können offene Stellen nicht mehr adäquat besetzen. Wenn der Betrieb dennoch irgendwie weiterläuft, führt das zu dem Eindruck, es ginge auch mit weniger Personal. So wird die ohnehin schon bis zum Anschlag angespannte Lage noch verschärft, Interaktionsarbeit findet nicht mehr statt. Dies wiederum befördert Gefühle von Erschöpfung, Burnout und moralischem Stress bei den Pflegenden, es folgen Arbeitsunzufriedenheit, (innere) Kündigung und Berufsflucht. Das spricht sich herum und wirkt sich wiederum auf die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen und damit die Qualität von Auszubildenden aus. Es scheint, dass die gesellschaftlichen Kosten der Pflege niedrig bleiben sollen und daher nicht ernsthaft versucht wird, den seit langem bestehenden Teufelskreis von schlechten Arbeitsbedingungen und hoher Belastung zu unterbrechen. Statt die Rolle der Pflege neu zu denken, wird die Strategie verfolgt, vermehrt niedrigqualifizierte Pflegekräfte einzusetzen und Pflegepersonal aus dem Ausland zu gewinnen. Eine Strategie, die nicht nachhaltig ist und durch Dequalifizierung die Versorgungsqualität und Sicherheit kranker und pflegebedürftiger Menschen gefährdet.
Berufe mit Zukunft und Potenzial
Pflegeberufe sind vielseitig, interessant und anspruchsvoll. Sie sie sind Berufe mit Zukunft und Potenzial und für ein ganzes Berufsleben geeignet. Vielfalt und Facettenreichtum der Pflegeberufe können in den drei wesentlichen Settings Krankenhaus, Pflegeheim und Pflege zu Hause umgesetzt werden. Erfolgsmodelle zeigen auf, warum Pflege das Rückgrat des Gesundheitssystems ist.
Das Anspruchsvolle an der Pflegearbeit ist die Interaktion mit den Betroffenen, die ein hohes Maß an methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen erfordert. Der Großteil der Pflegearbeit ist auf den Menschen gerichtet. Pflege wird erst durch persönliche Nähe und Beziehung wirksam, wobei es sich immer um eine professionelle Beziehung handeln muss, da Pflegearbeit als eine körperbezogene, interpersonale Interaktion ständig an den Grenzen der Tabuverletzung, des Zumutbaren, der Scham, des Ekels und der eigenen Betroffenheit stattfindet. Professionalität sorgt dafür, dass diese Grenzen nicht überschritten werden. Pflegearbeit ist immer im jeweiligen Kontext zu sehen, das Handeln muss auf die jeweilige Situation, auf die Gemütslage und Bedürfnisse der zu Pflegenden abgestimmt und daher immer neu adaptiert werden. Professionelle Pflege ist also ganz zentral auf die richtige Einschätzung einer Situation angewiesen und damit niemals nur eine Routinehandlung.
Dass Sorge- und Pflegearbeit Frauen zugeschrieben wird und Pflege- und Betreuungsberufe mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, prägt den Stellenwert der Pflege in der österreichischen Gesellschaft. Ein zweites, nicht minder dominierendes Phänomen ist die Ökonomisierung im Gesundheits- und Sozialbereich. Trotz aller technischer Entwicklungen in den vergangenen Jahrzehnten bleiben Gefühlsarbeit, Emotionsarbeit und Zugewandtheit aber wichtige Bestandteile der Pflegeberufe. Wenn diese zeitaufwändigen Aufgaben bei Personalknappheit eingespart werden, bedeutet das Geringschätzung und Abwertung und bleibt nicht ohne negative Folgen für Pflegende und Gepflegte. Wenn Arbeitsverdichtung, Zeitdruck und verringerte Entscheidungsspielräume spürbar werden, beeinträchtigt das die Qualität der pflegerischen Versorgung und berührt damit auch die unmittelbaren Interessen der kranken und pflegebedürftigen Menschen.
Nationaler Schulterschluss gefragt
Vor Mutlosigkeit sei dennoch gewarnt: Fehlentwicklungen sind keine Naturgesetze, sie können verändert werden. Die hohe Bindung von Pflegepersonen an ihren Beruf und ihr berufliches Selbstverständnis, das an der Sorge für die kranken und pflegebedürftigen Menschen orientiert ist, ist ein enormes Potenzial für Organisationen und Gesellschaft. Um dieses Potenzial zu nutzen, braucht es neben (berufs)politischem Engagement vor allem die Zivilgesellschaft und einen nationalen Schulterschluss zur Sicherung qualitätsvoller Pflege.
Buchempfehlung
Pflege im Fokus
Vor dem Hintergrund der Covid 19-Pandemie entstand das eben erschienene Buch „Pflege im Fokus“: In der ersten Welle spendete man dem Pflegepersonal noch Applaus als Anerkennung ihrer besonderen Leistungen und kündigte an, diese zu honorieren. Der Applaus und die Versprechen sind verebbt. Stattdessen wurde von einem Pflegenotstand gesprochen, als osteuropäische 24-Stunden-Betreuerinnen für Privathaushalte nicht mehr einreisen konnten. Diese verzerrte Wahrnehmung in Medien, Politik und Öffentlichkeit wollen die Autorinnen des Buchs geraderücken. Doris Pfabigan, Elisabeth Rappold, Berta Schrems und Gerda Sailer, Expertinnen aus Theorie und Praxis der Pflege, erzählen von den Leistungen und Bürden sowie den faszinierenden Facetten dieses Berufs.
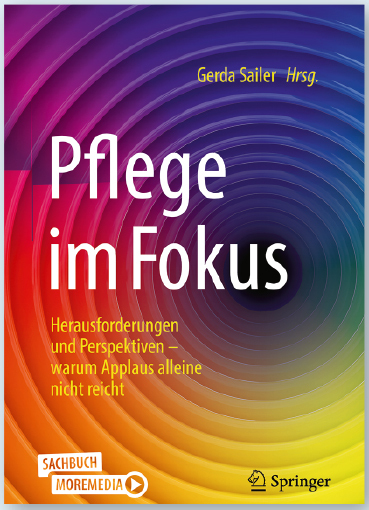

Footnotes
DR. ELISABETH RAPPOLD ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und hat an der Universität Wien Soziologie und Pflegewissenschaft studiert. Sie koordiniert in der Gesundheit Österreich GmbH — GÖG - alle pflegerelevanten Themen und arbeitet schwerpunktmäßig in den Bereichen Berufsbildentwicklung, Evaluierung und Entwicklung von Praxiswerkzeugen für Gesundheitsberufe, insbesondere für Pflegeberufe sowie Health Workforce Planning. Sie wirkt an Strategieprozessen und deren Umsetzung mit (Demenzstrategie, Diabetesstrategie) und hält zahlreiche Vorträge und Lehrveranstaltungen in diesen Themenbereichen


