Das HEILBERUFE PFLEGE KOLLEG
Ein gemeinsames Projekt von Springer Pflege — Redaktion HEILBERUFE, des Verbandes der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz und der Alice Salomon Hochschule Berlin — ist Fernfortbildung zum Mitmachen.
Jedes PflegeKolleg besteht aus mehreren Fachbeiträgen zu einem Thema und schließt mit einem Fragebogen ab.
Für die erfolgreiche Teilnahme an einem PflegeKolleg, die mit drei Punkten bewertet wird, erhält der Teilnehmer ein Zertifikat.
So nehmen Sie teil:
Füllen Sie als Abonnent/in den Fragebogen einfach unter springerpflege. de online aus. Sofort nach der Teilnahme erfahren Sie, ob Sie bestanden haben und können sich Ihr Zertifikat ausdrucken.
Nicht-Abonnenten benötigen für die Online-Teilnahme eine TAN, die beliebig aktiviert werden kann und vom Tag der Einlösung an vier Wochen gültig ist. Das PflegeKolleg-Mini-Abo, auch vier Wochen gültig, bietet unmittelbaren Zugriff auf alle aktuellen Kurse. TAN und Mini-Abo kosten je 15 € und können per E-Mail oder über springerpflege.de bestellt werden.
Beweglichkeit erhalten
Immobilität vermeiden Möglichst lange selbstständig mobil bleiben — das ist ein wichtiges Ziel von alten Menschen. Fachpflegende der Geriatrie können dies durch ein strukturiertes Vorgehen und bedürfnisorientiertes Pflegehandeln unterstützen. So können Komplikationen vermieden, der Pflegeaufwand reduziert und Mobilität erhalten werden.
Der Mensch lernt laufen, damit er sich in der Welt zurechtfindet. Die Fähigkeit, sich aus eigener Kraft von A nach B bewegen zu können — also körperlich mobil zu sein -, ist Ausdruck gelebter Autonomie und ein sehr komplexes Geschehen. Im Alter wird die Bedeutung der Mobilität besonders sichtbar, dann nämlich, wenn sie sich deutlich verschlechtert und sich daraus Konsequenzen für den Alltag ergeben, beispielsweise in Form von Sturz ereignissen mit unterschiedlichen Folgen. Daher ist der Erhalt der Mobilität ein zentrales Konzept in der geriatrischen Fachpflege und gehört zu den prominenten „geriatrischen Riesen“.
Das Konzept „Mobilität“ setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen und muss aus mehreren Perspektiven betrachtet werden. Alltagspraktisch bedeutet eine uneingeschränkte körperliche Mobilität, sich ohne fremde Hilfe und ohne Hilfsmittel bewegen zu können: die Toilette aufzusuchen, wann man möchte oder an den Kühlschrank zu gehen, wenn man Appetit verspürt. In diesem Sinne ermöglicht Mobilität Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Mobilität hat darüber hinaus einen sozialen Aspekt, da sie gesellschaftliche Teilhabe und Kontakt zu anderen Menschen ermöglicht. Fehlt dies, kann das zur Isolation und Vereinsamung führen — mit den bekannten Konsequenzen für Körper und Psyche. Auch auf die Gesundheitsversorgung hat eine veränderte Mobilität Auswirkungen, denn für mobilitätseingeschränkte Menschen bestehen im wahrsten Sinne des Wortes Hürden — auf dem Weg zu und innerhalb von Arztpraxen, Kliniken oder Therapieeinrichtungen. Somit berührt Mobilität drei verschiedene Ebenen, die es in der geriatrischen Fachpflege zu beachten gilt: die Person, die Umwelt und die Gesundheitsversorgung.
BUCHTIPP
Dietger Mathias
Fit und gesund von 1 bis Hundert mit Ernährung und Bewegung
Aktuelles medizinisches Wissen zur Gesundheit
Springer Verlag 2022
ISBN 978-3-662-64208-5 (Softcover), 29,99 Euro

Mobilitätsbeeinflussende Faktoren
Die körperlichen Umbauprozesse des Alters führen dazu, dass sich der Anteil von Muskulatur und Fettgewebe verändert. Diese Veränderungen setzen bereits ab dem 50. Lebensjahr ein und schreiten über Jahre hinweg langsam fort. Ein über das altersnormale Maß hinaus bestehender Muskelabbau wird als Sarkopenie bezeichnet. Dies kann dazu führen, dass sich im Laufe der Zeit Gebrechlichkeit (Frailty) einstellt, was sich wiederum negativ auf die Mobilität auswirkt und zu einem Teufelskreis führt. Dieser Entwicklung kann mit körperlicher Aktivität und einer angepassten vitaminreichen Ernährung entgegengewirkt werden, wie verschiedene Untersuchungen der letzten Jahre zeigen.
Menschen zwischen 18–64 Jahren sollten sich in der Woche mindestens zweieinhalb bis fünf Stunden moderat bewegen.
Für ein möglichst gesundes Alter empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Menschen zwischen 18–64 Jahren, sich in der Woche mindestens zweieinhalb bis fünf Stunden moderat zu bewegen. Dies sollte an mindestens zwei Tagen in der Woche durch ein alle Muskelgruppen berücksichtigendes Krafttraining ergänzt werden. Menschen ab 65 Jahren sollten mit gezielten Übungen das Gleichgewicht und die Koordination trainieren. Mattle et al. (2020) konnten in ihrer Übersichtsarbeit beispielsweise die positiven Effekte von tanzbasierten Bewegungsübungen zeigen. Tanzen fördert die Koordination und den Bewegungsapparat gleichermaßen. Das Sturzrisiko und die Sturzhäufigkeit können gesenkt und die Balance verbessert werden.
Neben den aufgeführten altersbedingten, physiologischen Prozessen können Akutereignisse und nachfolgende Komplikationen die Mobilität von alten Menschen negativ beeinflussen. Dazu gehören beispielsweise Stürze, Operationen, Infektionskrankheiten (z.B. Pneumonie, Covid-19), neurologische Erkrankungen oder Mangelernährung. Aber auch psychische Gesundheitsprobleme (z.B. Depressionen oder Angststörungen) haben einen Einfluss auf das Bewegungsverhalten alter Menschen.
Durch Screening und Assessment Situation einschätzen
Veränderungen in der Mobilität von alten Menschen sollten frühzeitig erkannt werden. Meist handelt es sich dabei um einen langsam verlaufenden Prozess, dessen Konsequenzen zu spät erkannt werden, wie eine Studie zur Bettlägerigkeit zeigen konnte. Demnach entwickelt sich Bettlägerigkeit in fünf Stufen und stellt sich in den meisten Fällen nicht plötzlich oder unvorhersehbar ein. Die Stufen sind: Instabilität, Ereignis, Immobilität, örtliche Fixierung, vollständige Immobilität. Sowohl der Immobilität als auch der Bettlägerigkeit geht also eine Zeit voraus, die durch die Betroffenen — mit Hilfe von Pflegenden — meist positiv beeinflusst und mit geeigneten Maßnahmen kompensiert werden könnte.
Pflegende in allen Settings sind gefordert, alte Menschen in ihrer körperlichen Beweglichkeit und ihrem Bewegungsverhalten aktiv zu unterstützen.
Um den Grad der Mobilität und beginnende Einschränkungen einzuschätzen, stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, die für die Erhebung der körperlichen Fitness von alten Menschen eingesetzt werden (Tab. 1). In der Regel wenden Physiothe rapeut*innen die Instrumente an. Aber auch Pflegende können sie nutzen. Die Tests sollten jedoch nicht durchgeführt werden, wenn die betroffenen alten Menschen über Schwindel klagen oder bereits stark in der Mobilität eingeschränkt sind, beispielsweise bei einer Halbseitenlähmung (Hemiparese) nach einem Schlaganfall.
Ein bestimmtes Instrument wird nicht empfohlen. Neben der mobilitätsfokussierten Situationserfassung sollen auch biografische, kognitive und psychische Ressourcen sowie der allgemeine Gesundheitszustand und bestehende Krankheiten eingeschätzt werden, da auch diese Komponenten Einfluss auf das Mobilitätsverhalten haben.
Mobilität gezielt ermöglichen
Die Bedeutung von Mobilität und ihrer Förderung ist in der Pflege offensichtlich. Pflegende in allen Settings sind daher gefordert, alte Menschen in ihrer körperlichen Beweglichkeit und ihrem Bewegungsverhalten aktiv zu unterstützen. Bewegung sollte in den normalen Alltag soweit wie möglich integriert werden, etwa im Rahmen der Körperpflege oder anderen Aktivitäten des täglichen Lebens. Die interprofessionell umgesetzten Maßnahmen müssen dem Mobilisationsgrad angepasst sein und unterscheiden sich, je nachdem, ob eine weitgehende Immobilität (Bettlägerigkeit) oder eine Teilmobilität außerhalb des Bettes vorliegt.
Da Bewegung und Mobilität individuelle und subjektive Phänomene sind, wird an dieser Stelle auf die detaillierte Ausarbeitung zu Einzelmaßnahmen verzichtet. Vielmehr sollen hier die Prinzipien der Bewegungsförderung und Prävention von Immobilität ins Zentrum gestellt werden. Bewegung soll in erster Linie Spaß machen und ohne Schmerzen oder andere belastende Symptome, beispielsweise Atemnot, möglich sein. Maßnahmen sollen für die Betroffenen einen erkennbaren Sinn haben und an die bestehenden Interessen und Fähigkeiten anknüpfen.
| Name und Art des Tests | Durchführung | Aufwand & Besonderheiten | Publiziert |
|---|---|---|---|
| Timed Up & Go: Performancetest zur MobilitÄtsmessung | Patient*in sitzt auf Stuhl (lehnt sich an, wenn mÖglich), bei Aufforderung steht Patient*in auf, geht 3 Meter, dreht sich um, geht zurück und setzt sich wieder; die Gesamtzeit in Sekunden wird gestoppt | 1–5 Minuten; Patient*in kann Durchführung 1x ohne Zeitmessung üben, Untersucher*in kann Ablauf 1x vormachen; 3-Meter-Markierung sinnvoll; kann als Verlaufskontrolle eingesetzt werden | Podsiadlo et al. (1991) |
| MobilitÄtstest nach Tinetti: Performancetest zur Prüfung von Balance und Gang | Testet Balance und GehfÄhigkeit (anhand von Aufstehen, Gehen, Drehen, Hinsetzen) | 5–10 Minuten; max. Punkte 28 (Balance 13; Gehen 15). Unter 20 Punkten: ErhÖhtes Stur zrisiko; unter 15 Punkten: deutlich erhÖhtes Sturzrisiko; Schulung für Testdurchführung nÖtig; meist in der Physiotherapie angewendet | Tinetti (1986) |
| Stuhl-Aufsteh-Test (Chair-Stand up) | Patient*in sitzt mit vor der Brust gekreuzten Armen; soll so schnell wie mÖglich 5x hintereinander aufstehen; Zeit wird gemessen | 2–3 Minuten; Werte über 12 Sekunden: erhÖhte Sturzgefahr; Patient*in sollte frei sitzen (nicht anlehnen); Übung sollte demonstiert werden, sonst einfach durchzuführen | k. A. |
| De Morton MobilitÄts Index (DEMMI): Performancetest mit 15 Items in fünf Kategorien (MobilitÄt im Bett, auf dem Stuhl, Stehen, Gehen und dynamisches Gleichgewicht) | Übungen werden im Bett, im Sitzen und im Gehen durchgeführt. Geprüft wird Gleichgewicht und MobilitÄt |
10 Minuten Score von 0–100 Punkte (je hÖher die Punktzahl desto besser die MobilitÄt); Instruktionshandbuch gratis online verfügbar |
Braun et al. (2015; deutsche Version) De Morton et al. (2008; australische Version) |
Die Tests kÖnnen unter kcgeriatrie.de/assessments-in-der-geriatrie/assessmentbereiche/mobilitaet/ heruntergeladen werden.
In der Pflege wird die Bewegung von Patient*innen im und außerhalb des Bettes als Mobilisation bezeichnet. Diese soll aktiv gestaltet werden, das heißt ein Herausheben aus dem Bett in den Stuhl bewirkt kaum das Erwünschte. Alten Menschen sollen Bewegungserfahrungen ermöglicht werden, um das Gefühl für den Körper und das Körperbild aufrechtzuerhalten und sich in ihrer Körperlichkeit wahrzunehmen. Dabei können auch kleine Bewegungen, wie etwa Schunkeln im Stuhl, hilfreich sein. Hilfsmittel zur Mobilisation sollten sinnvoll und angepasst an die Situation und die Person eingesetzt werden. (Der Beitrag basiert auf der Erstveröffentlichung in: PflegeZeitschrift, Ausgabe 6/2022)
PFLEGE EINFACH MACHEN
Bewegung und Mobilität zu erhalten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe der geriatrischen Fachpflege und kann einer zunehmenden Pflegebedürftigkeit entgegenwirken.
Situation, Ziele und Maßnahmen müssen strukturiert und individuell erfasst werden. Bewegung sollte als normale Alltagstätigkeit verstanden werden.
Sinnorientierte Interventionsprogramme können helfen, die Bewegungssituation von alten Menschen zu verbessern.
Schlüsselwörter: Sturz, Bewegung, Mobilität
Blasenschwäche vorbeugen
Kontinenz fördern Auch wenn das Thema Inkontinenz immer mehr aus der Tabuecke geholt wird — noch zu viele Betroffene leiden unter dem unfreiwilligen Harnverlust und seinen Auswirkungen. Nicht selten führt dies zu großen Einschränkungen im Alltag. Inkontinenz vorbeugen, frühzeitig erkennen und Hygienematerialien gezielt einsetzen, sind Aufgaben zur Unterstützung im pflegerischen Ausscheidungsmanagement.
Das Alter geht mit zahlreichen körperlichen und psychischen Veränderungen einher. Für die Betroffenen ist es oft nicht einfach, damit umzugehen. Das gilt auch für die Inkontinenz. Der Begriff bezeichnet der Deutschen Kontinenz Gesellschaft zufolge die mangelnde oder fehlende körperliche Fähigkeit, den Inhalt der Harnblase oder des Darmes „sicher zu speichern und selbstbestimmt zu entscheiden, wo und wann er entleert werden soll.“ Häufig ist dies mit einer erschwerten Körper-beziehungsweise Intimhygiene mit nachfolgenden Problemen verbunden.
Obwohl das Verdauungs- und das Harnsystem von der Inkontinenz betroffen sein können, wird der Begriff meist in Zusammenhang mit ungewolltem Harnverlust verwendet. Die Stuhlinkontinenz bleibt in der öffentlichen Diskussion weitgehend unangetastet. Dabei leiden in Deutschland schätzungsweise fünf Millionen Menschen an einer Stuhlinkontinenz. Frauen sind aufgrund der anatomischen Verhältnisse und möglicher Geburten häufiger davon betroffen. Auf vier bis fünf Frauen kommt ein Mann, der die Stuhlausscheidung nicht bewusst kontrollieren kann.
Inkontinenz ist ein häufiges Phänomen im Alter und zählt nach Zeyfang zu den „geriatrischen Riesen“ bzw. den „geriatrischen I‘s“. Verfügbare Daten zeigen, dass elf Prozent der Menschen über 60 Jahre daran leiden. Bei Menschen ab 80 Jahren beträgt die Häufigkeit bereits 30%. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich höher. Die Prävalenz steigt jedoch altersabhängig deutlich an (Tab. 1). Ist im jungen Alter die Hälfte der Betroffenen weiblich, gleicht sich die geschlechtsspezifische Häufigkeit mit fortschreitenden Lebensjahren an, d.h. ähnlich viele Männer und Frauen leiden in fortgeschrittenem Alter an Harninkontinenz. Es gibt verschiedene Formen der Harninkontinenz. In der Pflege sind vor allem die nachfolgend aufgeführten relevant:
_ Belastungsinkontinenz (ehemals Stressinkontinenz genannt): Harnverlust beim Niesen, Husten, Lachen oder Tragen von schweren Gegenständen oder Taschen
_ Dranginkontinenz: Syndrom der überaktiven Blase, Betroffene erreichen die Toilette nicht mehr rechtzeitig
_ Mischinkontinenz: Kombination von Belastungs- und Dranginkontinenz
_ Überlaufinkontinenz: Urin kann bei voller Blase nicht gehalten werden, z.B. durch eine Schwächung der Blasenmuskulatur
Kontinenzförderung kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Betroffenen motiviert und aktiv mitmachen und sich als wichtigen Teil des Vorhabens verstehen.
Frauen leiden eher an einer Belastungs- und Männer eher an einer Dranginkontinenz. Im Alter ab 80 Jahren gleicht sich dies zwischen Frauen und Männern an, so dass in der geriatrischen Fachpflege vor allem die Behandlung der Dranginkontinenz im Vordergrund steht. Die Ursachen der Inkontinenz liegen bei Frauen meist in den hormonellen Veränderungen der Postmenopause und an der Anzahl der Geburten. Bei Männern sind vor allem Behandlungen von Prostataproblemen dafür verantwortlich.
SPRINGER PFLEGE KONGRESS
Kongress Pflege, 27. und 28. Januar 2023
Der Leitkongress für Führungskräfte in der Pflege: Management · Bildung · Recht · Personal · Politik · Praxis
gesundheitskongresse.de
Auswirkungen der Inkontinenz nicht unterschätzen
Lange wurde die Inkontinenz isoliert als unabänderliche Alterserscheinung angesehen. Inzwischen zeigen sich die Komplexität des Phänomens und vor allem die zahlreichen Auswirkungen, die damit einhergehen. Neben der deutlich eingeschränkten Lebensqualität für die Betroffenen spielen das erhöhte Risiko für Stürze (rasches Aufsuchen der Toilette bei eingeschränkter Mobilität als häufigste Ursache) und Hautveränderungen/-irritationen eine große Rolle. So zeigt sich, dass eine bestehende Harninkontinenz ein wichtiger Indikator für eine Heimeinweisung ist. Das heißt, Menschen mit Inkontinenz müssen eher in einer stationären Einrichtung gepflegt werden und können oft deswegen nicht im häuslichen Umfeld verbleiben. Neben der körperlichen Dimension dürfen die sozialen Aspekte nicht vernachlässigt werden. Scham und Angst, der ungewollte Harnverlust könne von außen bemerkt werden, können zum sozialen Rückzug mit nachfolgender Einsamkeit und Isolation führen. Bisher noch kaum diskutiert werden die finanziellen Auswirkungen der Inkontinenz. Inzwischen stehen zwar verschiedene Inkontinenzmaterialien zur Verfügung, die individuell je nach Ausscheidungsverhalten ausgewählt werden können. Auch wenn die Krankenkassen einen Teil der Kosten für diese Materialien übernehmen, müssen die Betroffenen Anteile davon übernehmen. Für alte Menschen, die über geringe finanzielle Mittel verfügen, kann dies belastend sein. Nicht selten berichten Pflegefachpersonen in der ambulanten Versorgung, dass Inkontinenzmaterialien aus diesen Gründen nicht genutzt oder mehrmals verwendet werden. Diese Situationen stellen aufgrund der Geruchsbildung große Herausforderungen für die Pflegenden und das soziale Umfeld dar.
Situationen individuell und einfühlsam erfassen
Um pflegerisch wirksam helfen zu können, ist es zunächst wichtig, die Situation in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Dazu gehören auch das Wohlbefinden und die subjektive Sicht der Betroffenen. Neben dem Miktionsprotokoll (Dokumentation der täglichen Trinkmenge, der Häufigkeit des Toilettengangs und der Urinmenge) sollten die Patient*innen in der Anamnese in Kombination mit einem Assessmentinstrument befragt werden. Eventuell kann das pflegerische Assessment auf mehrere Gespräche verteilt werden, wenn es zu anstrengend für die Betroffenen sein sollte. Bei Betroffenen mit kognitiven Veränderungen muss ein angepasstes Vorgehen gewählt werden. Im Pflegegespräch sollten folgende Informationen eingeholt werden:
_ Seit wann besteht die Inkontinenz?
_ Wurden die Ursachen der Inkontinenz abgeklärt? Wenn ja, welche Befunde gibt es?
_ Wie häufig am Tag wird ungewollt Harn verloren?
_ Zu welchen Zeiten über 24 Stunden tritt die Inkontinenz auf?
_ Welche Form der Inkontinenz liegt vor (nach den Merkmalen der Inkontinenz wie oben aufgeführt fragen)?
_ Mit welchen Strategien wurde der Inkontinenz bisher begegnet (Trinkverhalten, Toilettentraining, Materialien, andere Hilfsmittel, Operationen)?
_ Wie hoch ist Ihr Leidensdruck, wie stark fühlen Sie sich im Alltag durch die Inkontinenz eingeschränkt?
Manche ältere Menschen gehen sehr oft zur Toilette, ohne dass ein ausreichender Fülldruck vorliegt. Das normale Ausscheidungsverhalten wird quasi verlernt.
Inkontinenz ist inzwischen zumindest in der Frauengesundheitsversorgung ein wichtiges Thema. So überrascht es nicht, dass die meisten Erhebungsinstrumente den Fokus auf weibliche Inkontinenz-Betroffene legen. Die stärksten Auswirkungen der Harninkontinenz zeigen sich im psycho-sozialen Bereich und der dadurch eingeschränkten Lebensqualität. Ein viel genutztes Instrument ist beispielsweise der King Health Questionnaire, der auch in deutscher Sprache auf Gültigkeit und Zuverlässigkeit getestet wurde. Er kann bei Frauen bei verschiedenen Arten der Inkontinenz und bei Männern mit überaktiver Blase angewendet werden. Der Fragebogen besteht aus 21 Positionen. Die maximale Punktezahl beträgt 100; je höher der Wert desto stärker ist die gesundheitsbezogene Lebensqualität eingeschränkt. Weitere Beispiele möglicher Assessmentinstrumente finden sich bei Martin et al.

Kontinenz fördern als wichtige pflegerische Aufgabe
In der Pflege wird häufig der Fokus auf den Umgang mit der Inkontinenz gelegt. Das heißt, die pflegerische Versorgung konzentriert sich vielfach auf die Kompensation des Leidens und damit auf die Versorgung mit Inkontinenzmaterial. Dabei sollte in erster Linie die Kontinenz — also die Fähigkeit, Harn zu behalten — gefördert werden. Je früher dies als pflegerischer Auftrag wahrgenommen wird, desto eher lässt sich die Inkontinenz beeinflussen. Kontinenzförderung ist ein Prozess, der aber nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Betroffenen motiviert und aktiv mitmachen und sich als wichtigen Teil des Vorhabens verstehen. Leider scheitert die Kontinenzförderung häufig an eben diesen Aspekten. Auch kognitive Veränderungen wie Delir oder Demenz behindern den Einbezug der Betroffenen — und dadurch den Erfolg der Maßnahmen — mitunter erheblich. Pflegende sollen daher stets sorgsam erfassen und abwägen, welche Maßnahmen und unterstützenden Handlungen realistisch und zielführend sind.
Älter werdende Menschen gewöhnen sich häufig an, sehr oft zur Toilette zu gehen, ohne dass ein ausreichender Fülldruck vorliegt. Die Angst, später nicht rechtzeitig die Blase entleeren zu können, führt dann dazu, dass das normale Ausscheidungsverhalten quasi verlernt wird. Dies begünstigt die Entstehung der Inkontinenz. Betroffene sollten entsprechend informiert und zum Blasentraining motiviert werden. Die Förderung der Kontinenz stützt sich somit auf zwei Säulen: allgemeine und spezifische Maßnahmen (Tab. 2). Je früher die Maßnahmen angeboten und umgesetzt werden, desto stabiler kann sich die Ausscheidungssituation gestalten.
| Alter | Harninkontinenz in % | Belastungsinkontinenz in % | Dranginkontinenz in % | gemischte Form in % |
|---|---|---|---|---|
| 60–69 | 50 | 23,1 | 14 | 12,9 |
| 70–79 | 55,3 | 23,3 | 14 | 18 |
| über 80 | 60,8 | 13,7 | 33,3 | 13,7 |
Quelle: Schreiber Pedersen et al. 2017: 942
| Fokus | Maßnahmen |
|---|---|
| Allgemeine Maßnahmen |
_ Für ausreichende Flüssigkeitszufuhr sorgen, ein Flüssigkeitsdefizit kann die Inkontinenz begünstigen _ Wenn mÖglich Gewicht reduzieren _ Ausreichendes Obstipationsmanagement _ FÖrderung der Autonomie, z.B. durch ausreichende Beleuchtung, kurze Wege, angepasste Kleidung, erhÖhte Toilettensitze |
| Spezifische Maßnahmen |
_ Toilettentraining zu individuellen oder festgelegten Zeiten _ Angebotener Toilettengang _ Beckenbodentraining _ Hilfsmittelversorgung (Inkontinenzmaterial, Würfel, Pessare) |
Quelle: DNQP 2014
Das Toilettentraining kann die Situation insbesondere von Menschen mit leichten und mittleren kognitiven Veränderungen verbessern. Kann die Kontinenz mit diesen Maßnahmen nicht gefördert oder ausreichend erhalten werden, sollte parallel die Versorgung mit Hygienematerial begonnen werden. Die Materialien weisen unterschiedliche Füllmengen auf und müssen individuell angepasst und ausgewählt werden.
Es ist auch zu beachten, dass die Einlagen die Beweglichkeit und Mobilität der alten Menschen einschränken können. Durch zielgruppenspezifische Information kann die Adhärenz der Betroffenen verbessert und Lebensqualität zurückgewonnen werden.
PFLEGE EINFACH MACHEN
Frauen leiden eher an einer Belastungs- und Männer eher an einer Dranginkontinenz. Im Alter ab 80 Jahren gleicht sich dies zwischen Frauen und Männern an, so dass in der geriatrischen Fachpflege vor allem die Behandlung der Dranginkontinenz im Vordergrund steht.
Lange wurde Inkontinenz isoliert als unabänderliche Alterserscheinung angesehen. Inzwischen zeigen sich die Komplexität des Phänomens und die Auswirkungen, die damit einhergehen.
Um pflegerisch wirksam helfen zu können, ist es zunächst wichtig, die Ist-Situation in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Dazu gehören das Wohlbefinden und die subjektive Sicht der Betroffenen.
Pflegende sollen bei der Kontinenzförderung stets sorgsam erfassen und abwägen, welche Maßnahmen und unterstützenden Handlungen realistisch und zielführend sind.
Schlüsselwörter: Geriatrische I’s, Inkontinenz, Formen der Harninkontinenz, Kontinenzförderung
BUCHTIPP
Peter Petros, Joan McCredie, Patricia Skilling
Ratgeber Inkontinenz und Beckenbodenbeschwerden
Hilfreiche neue Therapie nach dem integralen System
Springer Verlag 2017
ISBN 978-3-662-50469-7 (Soft-Cover), 23,42 Euro
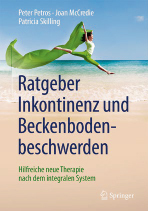
Kognitiven Abbau mindern
Schleichende Veränderungen frühzeitig erkennen Die „geriatrischen Riesen“ nehmen auch die kognitiven Veränderungen im Alter in den Blick. Verschiedene pflegerische Ansätze können die Situation der Betroffenen verbessern. Neben Einschränkungen im täglichen Leben sind soziale Isolation und Einsamkeitserfahrungen alter Menschen ein gesellschaftliches Problem.
Im Alter tritt nicht nur ein körperlicher, sondern auch ein psychischer Wandel ein. Neben einem erhöhten Risiko eine Depression zu entwickeln, kommt es auch häufiger zu geistig-kognitiven Veränderungen. Dieses Phänomen wurde in der Reihe der „geriatrischen I’s“ nach Zeyfang aufgenommen und wird dort als intellektueller Abbau bezeichnet. Dieser eher defizitorientierte und durch die Bezeichnung „Abbau“ negativ belegte Begriff entspricht nicht dem professionellen Pflegeverständnis, das laut Kitwood den Fokus auf die vorhandenen Ressourcen und das Personsein der erkrankten Menschen legt. Aus diesem Grund werden Verwirrtheit, Desorientiertheit oder andere hirnorganische Phänomene nachfolgend als kognitive Veränderungen bezeichnet. Neben der Ressourcenorientierung werden damit auch die Individualität der Betroffenen und die Symptomvielfalt in den Vordergrund gerückt.
Ursachen sorgsam erfassen
Kognitive Veränderungen bei alten Menschen haben unterschiedliche Ursachen, die stets sorgsam erfasst und validiert werden müssen. Denn zu oft werden sie vorschnell als demenzielle Entwicklung interpretiert, obwohl gar keine hirnpathophysiologischen Prozesse vorliegen und andere Gründe dafür verantwortlich sind. In der Praxis erweist es sich ohnehin oft als schwierig, eindeutig und frühzeitig zwischen physiologischen und pathologischen Alterungsprozessen unterscheiden zu können. Nicht selten leiden alten Menschen beispielsweise an einem nicht erkannten und daher nicht behandelten Vitamin B12-Mangel. Zum einen können die Ernährungsgewohnheiten dafür verantwortlich sein. Zum anderen kann sich ein Mangel einstellen, weil B12 im Magen-Darm-Trakt nicht ausreichend aufgenommen werden kann. Häufig ist in solchen Fällen der intrinsische Faktor im Magensaft der Betroffenen reduziert. Ein ausgeprägter Vitamin-B12-Mangel kann zu Konzentrationsstörungen bis zu Verwirrtheitszuständen führen und somit Symptome verursachen, die als hirnorganische Veränderungen fehlinterpretiert werden können. Verändert sich beispielsweise die Gedächtnisleistung auffallend, gehört die Bestimmung verschiedener Blutwerte daher unbedingt zum diagnostischen Vorgehen. Schwankungen im Vitaminhaushalt können vielfältige Folgen haben. Nicht vollständig geklärt ist bisher jedoch, welche Rolle das Vitamin B12 bzw. ein Mangel daran bei der Entstehung einer manifesten Demenz — beispielsweise bei Morbus Alzheimer — spielt.
Flüssigkeitsmangel oder Schmerzen (nach einem Sturz, bei einem Harnwegsinfekt) wiederum können eine akute Desorientierung bei alten Menschen auslösen. Diese als Delir bezeichnete Situation kann sich innerhalb weniger Stunden entwickeln. Bis dahin kognitiv gesunde alte Menschen können plötzlich orientierungseingeschränkt, sehr unruhig oder in sich gekehrt sein. Eine akute Verwirrtheit kann mit geeigneten Maßnahmen meist wieder stabilisiert und die Symptome innerhalb weniger Tage gelindert werden. Die wichtigste Pflegemaßnahme bei Delir ist jedoch die Prävention. Umgebungsfaktoren und die individuelle Situation alter Menschen sollte daher stets umfassend eingeschätzt und mögliche Auslöser eines Delirs erkannt und behoben werden.

Mit höherem Alter steigt das Risiko, an einer Form der Demenz zu erkranken. Man schätzt, dass 36% der Menschen über 90 Jahren hirnorganische bzw. demenzielle Veränderungen aufweisen. Am häufigsten tritt die Alzheimerdemenz auf, gefolgt von der vaskulären Demenz. Frauen erkranken häufiger als Männer, dies zeigt sich bereits in der Altersgruppe zwischen 65–69 bzw. 70–74 deutlich. In höherem Alter zeigt sich dies noch ausgeprägter. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die Lebenserwartung von Frauen höher ist. Ende 2021 waren nach Angaben der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in Deutschland schätzungsweise knapp 1,8 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich höher.
Denkprobleme nehmen zu
Bei einigen älteren Erwachsenen zeigen sich circa ab dem sechsten Lebensjahrzehnt mehr Gedächtnis- oder Denkprobleme als bei anderen Menschen im gleichen Alter. Dieser Zustand wird als leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment, MCI) bezeichnet und kann häufig in der geriatrischen Praxis beobachtet werden. Erkrankungen wie Diabetes, Depressionen und Schlaganfall können das Risiko erhöhen, an MCI zu erkranken. Die Symptome sind nicht so schwerwiegend wie bei der Alzheimer-Krankheit. So treten beispielsweise bei MCI keine Persönlichkeitsveränderungen oder andere Probleme auf, die für die Alzheimer-Demenz charakteristisch sind. Die von den Veränderungen Betroffenen sind noch in der Lage, für sich selbst zu sorgen und ihren normalen täglichen Aktivitäten nachzugehen. Noch ist nicht vollständig geklärt, ob Menschen mit MCI später an einer manifesten Demenz erkranken können bzw. ob MCI als Risikofaktor für demenzielle Entwicklungen gewertet werden muss.
Personzentriert pflegen — Lebensqualität fördern
Die Pflege von Menschen mit kognitiven Veränderungen beziehungsweise Demenz zeichnet sich durch die starke Orientierung an der Person, an ihren Bedürfnissen und den individuellen Ressourcen aus. Dafür hat sich der Ansatz der Personzentrierung nach Tom Kitwood durchgesetzt. Kitwood stellt dabei die menschlichen Bedürfnisse von Liebe/Wertschätzung, Trost, Bindung, Beschäftigung, Identität und Einbeziehung in den Vordergrund (Abb. 1, eonly). In vielen Fällen können die Betroffenen jedoch diese Bedürfnisse nicht mehr verbal formulieren und eindeutig kommunizieren. Sie wählen dann andere Ausdrucksweisen, die nicht selten als störend oder herausfordernd von der Umwelt wahrgenommen werden. Dazu gehören das rastlose Herumgehen, Hauen oder Schreien. Das Verhalten ist primär nicht aggressiv oder schädigend motiviert, es ist vielmehr der machtlose Versuch der Betroffenen, mit und in der sie umgebenden Welt, die für sie zunehmend unverständlich wird, umzugehen. Häufig zeigen sich auch Ängstlichkeit, Reizbarkeit und/oder Enthemmung. Dies geht mit großen Herausforderungen für die Pflegenden und die pflegenden Angehörigen einher.

Auslöser ist oft Überforderung
Im Umgang mit herausfordernden Verhalten ist es bedeutsam, die Einfluss- und Entstehungsfaktoren zu verstehen und situativ zu erkennen. Denn Auslöser für das lebensqualitätsbeeinflussende Verhalten ist meist eine Überforderung der Betroffenen oder ihre ungestillten Bedürfnisse. Um diese Faktoren zu erfassen, können Pflegende auf das bedürfnisorientierte Verhaltensmodell — kurz NDBModell genannt (need-driven dementia compromised behaviour model) — zurückgreifen (Abb. 2). Das in den 1990er Jahren entwickelte Modell bietet Anhaltspunkte, über die Betreuungspersonen Bescheid wissen sollten. Das sind beispielsweise aussagekräftige Informationen zur Biografie, zu Vorlieben, Abneigungen, Stressoren und zu individuellen Interventionen, die Ruhe und Geborgenheit vermitteln.
Gesellschaftlicher Rückzug und ein kleiner werdender Kreis an engen Bezugspersonen kennzeichnen häufig die Situation alter Menschen.
Nicht alle im Modell aufgenommenen Aspekte sind von außen beeinflussbar, beispielsweise das Stadium der kognitiven Veränderungen der Betroffenen oder deren Persönlichkeitsstruktur. Das professionelle Pflegehandeln ist daher vor allem bei den proximalen/ nahen Faktoren angesiedelt, denn diese gehören überwiegend zu den Aktivitäten des täglichen Lebens und der Umgebungsgestaltung. Ein Bereich, der primär in den Verantwortungs- und Gestaltungsbereich von Pflegenden fällt. Wichtig ist, dass ein sehr unruhiges, gestresst wirkendes Verhalten als solches erkannt und als Ausdruck verminderter Lebensqualität für die Betroffenen verstanden wird. In solchen Situationen sollten Empathie, Zugewandtheit und Ruhe die pflegerische Beziehung kennzeichnen.
Soziale Isolation und ihre Folgen ernst nehmen
Kognitive Veränderungen haben weitreichende Folgen für die Betroffenen. Ebenso einschneidend wie Desorientierung, Sprachlosigkeit oder der Verlust über die bewusste Steuerung von Körperfunktionen sind auch die sozialen Auswirkungen. Gesellschaftlicher Rückzug und ein kleiner werdender Kreis an engen Bezugspersonen kennzeichnen häufig die Situation von alten Menschen. Mobilitätseinschränkungen, Pflegebedürftigkeit, Tod des Ehepartners/ der Ehepartnerin, Wegzug der Kinder oder kognitive Veränderungen sind nur ein paar der Gründe, die zur sozialen Isolation von alten Menschen führen können.
Welche Folgen das Alleinsein für alte Menschen hat, zeigte sich eindrücklich in der Hochphase der Covid-Pandemie. Fehlende Ansprache, kaum Abwechslung im Alltag, aber auch die wegfallende soziale Kontrolle hat die Situation bei vielen alten Menschen verschlechtert. Man schätzt, dass ca. 50% der Menschen im Alter von sozialer Isolation bedroht sind und dass etwa ein Drittel der Menschen später im Leben Einsamkeitserfahrungen machen werden. Obwohl Einsamkeit ein sehr häufiges gesellschaftliches Phänomen ist — darüber gesprochen wird kaum. Zu groß ist offenbar die Scham darüber, sich alleine und einsam zu fühlen. Bedingt durch die hohe Lebenserwartung sind vor allem Frauen davon betroffen. Nicht selten pflegen sie beispielsweise über viele Jahre hinweg ihre Ehepartner und sind durch die Pflegetätigkeit stark an die Häuslichkeit gebunden. Dies führt dazu, dass Freund- und Nachbarschaften häufig vernachlässigt werden.
Phänomen Einsamkeit in den Fokus
Auch die Teilhabe an gesellschaftlichen Ereignissen (beispielsweise Kultur, Feste) ist erschwert. Sozialer Austausch und Kontakte verschieben sich in der digitalen Welt darüber hinaus immer mehr vom direkten Gegenüber ins Handy, ins Internet, in die virtuelle Welt. Die technischen Möglichkeiten entwickeln sich rasant und viele vor allem alte und sehr alte Menschen können damit nicht Schritt halten. Auch das nötige technische Equipment steht nicht allen zur Verfügung, bedingt es doch ein entsprechendes Knowhow für die Anschaffung und die Bedienung oder zumindest die Unterstützung von Personen, die sich darin und damit gut auskennen. Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Phänomen, das man sehr ernst nehmen sollte.
Verschiedene Länder (z.B. England) haben darauf bereits reagiert und das Thema auf die politische Agenda gesetzt und Ministerien eingerichtet. Die Gefahren eines einsamen Alters werden sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter vergrößern. Pflegende sollten die Beziehungssituation und das Netzwerk alter Menschen im Assessment gezielt erfassen. Denn soziale Isolation und Einsamkeitserfahrungen können unter anderem das Risiko erhöhen, an einer Depression oder einer Demenz zu erkranken. Im Sinne einer vorausschauenden, Lebensqualität verbessernden Pflege und Gesundheitsversorgung sollte dieser Aspekt bewusst wahrund ernstgenommen werden.
PFLEGE EINFACH MACHEN
Die Pflege von Menschen mit kognitiven Veränderungen bzw. Demenz zeichnet sich durch die starke Orientierung an der Person, an ihren Bedürfnissen und den individuellen Ressourcen aus.
Im Umgang mit herausfordernden Verhalten ist es bedeutsam, die Einfluss- und Entstehungsfaktoren zu verstehen und situativ zu erkennen. Denn Auslöser für das lebensqualitätsbeeinflussende Verhalten ist meist eine Überforderung der Betroffenen oder ihre ungestillten Bedürfnisse.
Das professionelle Pflegehandeln ist vor allem bei Faktoren angesiedelt, die zu den Aktivitäten des täglichen Lebens und der Umgebungsgestaltung gehören.
Soziale Isolation und Einsamkeitserfahrungen können das Risiko, an einer Depression oder einer Demenz zu erkranken, erhöhen. Im Sinne einer vorausschauenden, Lebensqualität verbessernden Pflege und Gesundheitsversorgung sollte dieser Aspekt bewusst wahr- und ernstgenommen werden.
Schlüsselwörter: Geriatrische I’s, kognitive Veränderungen, Demenz, Delir
Fragebogen: Gut altern
Es ist jeweils nur eine Antwort richtig.
1. Was versteht man unter dem Begriff Sarkopenie?
A Die defizitäre Versorgung mit Makro- und Mikronährstoffen
B Ein über das altersnormale Maß hinaus bestehender Muskelabbau
C Gebrechlichkeit, die sich im Laufe der Zeit einstellt
2. Wie lautet die WHO-Empfehlung an Menschen zwischen 18–64 Jahren für ein möglichst gesundes Alter?
A Mindestens zweieinhalb bis fünf Stunden moderate Bewegung in der Woche
B Mindestens eineinhalb bis drei Stunden moderate Bewegung in der Woche
C Mindestens zwei bis vier Stunden moderate Bewegung in der Woche
3. Es gibt verschiedene Instrumente, die für die Erhebung der körperlichen Fitness von alten Menschen eingesetzt werden. Was wird nach Tinetti getestet?
A Mobilität im Bett
B Das Aufstehen vom Stuhl
C Balance und Gehfähigkeit
4. Was gilt für die geschlechtsspezifische Prävalenz bei Inkontinenz ab einem Alter von 80 Jahren?
A In fortgeschrittenem Alter leiden mehr Frauen an Inkontinenz.
B Mehr Männer leiden in hohem Alter an Inkontinenz.
C Ähnlich viele Männer und Frauen leiden in fortgeschrittenem Alter an Harninkontinenz.
5. Wodurch ist die Dranginkontinenz gekennzeichnet?
A Syndrom der überaktiven Blase, Toilette wird nicht mehr rechtzeitig erreicht
B Urin kann bei voller Blase nicht gehalten werden.
C Harnverlust beim Niesen, Husten, Lachen
6. Welches ist ein viel genutztes Instrument zur Erhebung weiblicher Inkontinenz?
A Nursing Delirium Screening Scale
B King Health Questionnaire
C Barthel Index
7. Warum gehört die Bestimmung verschiedener Blutwerte zum diagnostischen Vorgehen bei Konzentrationsstörungen oder Verwirrtheit?
A Weil das Standard ist
B Blutwerte müssen aus diesem Grund nicht bestimmt werden.
C Weil z.B. ausgeprägter Vitamin-B12-Mangel Symptome verursachen kann, die als hirnorganische Veränderungen fehlinterpretiert werden.
8. Mit höherem Alter steigt das Risiko, an einer Form der Demenz zu erkranken? Welche ist die häufigste?
A Die Alzheimer-Demenz, gefolgt von der vaskulären Demenz
B Die vaskuläre Demenz, gefolgt von der Alzheimer-Demenz
C Die frontotemporale Demenz
9. Das bedürfnisorientierte Verhaltensmodell bei Demenz unterscheidet zwischen Hintergrundfaktoren und nahen Faktoren? Welche gehören zu letzteren?
A Motorische Fähigkeiten
B Familienstand, Beruf
C Hunger und Durst, Emotionen
10. Einsamkeit ist ein sehr häufiges gesellschaftliches Problem. Welches europäische Land hat mit einem Ministerium darauf reagiert?
A Deutschland
B England
C Alle europäischen Länder
PFLEGEKOLLEG ONLINE ONLY
Mit dem HEILBERUFE PflegeKolleg können sich alle Pflegekräfte — auch in Österreich — online fortbilden und Punkte sammeln. Wenn Sie 9 der 10 Fragen richtig beantworten, können Sie sich ein anerkanntes Zertifikat, das Ihnen 3 Punkte im Rahmen der Registrierung beruflich Pflegender (RbP — https://doi.org/www.regbp.de) beim Deutschen Pflegerat (DPR) sichert, sofort ausdrucken.
Teilnehmer aus Österreich erhalten 3 ÖGKV PFP® (Pflegefortbildungs-punkte) — 2 ÖGKV PFP = 1 Fortbildungsstunde laut GuKG. Die Teilnahme am HEILBERUFE PflegeKolleg ist ab sofort nur noch online möglich. Bitte senden Sie uns keine Fragebögen per Post oder als Fax zu.
Teilnahmebedingungen und Preise für Ambulante Dienste und Kliniken auf Anfrage an:
E-Mail: heilberufe@springer.com
So einfach nehmen Sie teil
Abonnenten: Die Teilnahme am PflegeKolleg ist für Abonnenten von HEILBERUFE und PROCARE kostenlos. Nach dem Login/Registrierung auf springerpflege. de füllen Sie einfach den Fragebogen aus. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: kundenservice@springerpflege.de
Zwei Wege für Nicht-Abonnenten
TAN: Auf springerpflege.de können Sie eine oder mehrere Transaktionsnummern (TAN) bestellen. Jede TAN (15 €) ist ab dem Einlöse-Datum einen Monat gültig. Mit der TAN starten Sie, wann Sie wollen.
PflegeKolleg Mini-Abo: Für 15 € können Sie vier Wochen lang an allen PflegeKollegs auf springerpflege.de teilnehmen. Das Mini-Abo startet unmittelbar nach dem Kauf.
Einsendeschluss für das PflegeKolleg „Analgesie aktuell“ ist der 27. März 2023.
Die Auflösungen der abgelaufenen Pflegekollegs finden Sie auf springerpflege.de
Dr. phil. Elke Steudter



